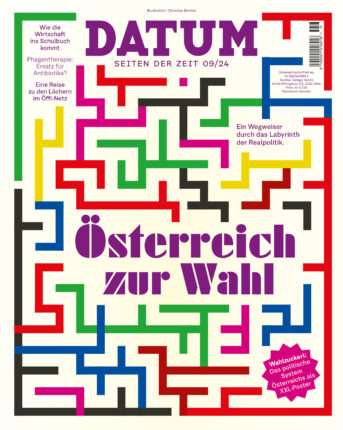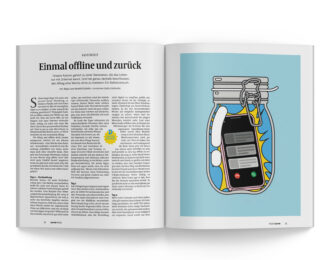Löcher im Netz
Wer nach Fendels will, braucht ein Auto oder viel Geduld. Das Tiroler Bergdorf ist einer der weißen Flecken auf der Landkarte des öffentlichen Verkehrs. Ein Besuch.
Gibt es denn keine Karten für die Gondel mehr?‹, sage ich und blicke zwischen dem leeren Kassahäuschen und dem einsamen Stationsleiter mit weißem Kapitänsbart hin und her. Auf meine Frage antwortet er mit armverschränktem Schweigen, schließlich weist mich sein sonnengegerbter Zeigefinger zu einem Touchscreen. Wenig später steige ich als wahrscheinlich letzter Fahrgast für heute allein in die Kabine. Momentan bin ich nur dankbar, nicht den Berg hinaufwandern zu müssen. Sieben Stunden nach Beginn meiner Reise ist mein Ziel endlich in Sichtweite. Ich will von Wien nach Fendels. Und wer nach Fendels will, braucht entweder ein Auto oder viel Geduld.
Das Tiroler Bergdorf ist eine von nur acht österreichischen Gemeinden, in denen es keine einzige Bushaltestelle, keinen einzigen Bahnsteig gibt und die laut Österreichischer Raumordnungskonferenz nicht einmal die Bedingungen für Basiserschließung erfüllen. Die Fendler, Pfaffinger und Holzhausner müssten zur nächsten Station 40 bis 70 Minuten Fußweg auf sich nehmen. Ihre Orte sind abgeschnitten von unserem Öffi-Netz und stehen stellvertretend für die Verkehrsprobleme im ländlichen Raum. Meine Reise vom bestens erschlossenen Wien in die schwer erreichbaren Berge Tirols ist deshalb auch eine Reise zu den weißen Flecken der Mobilitätswende.
Denn die steht und fällt mit der Frage, ob sie auch am Land funktioniert – und das wäre zur Erreichung unserer Klimaziele bitter nötig. Die Emissionen des Verkehrssektors sind nach denen der Industrie die zweithöchsten, stiegen bis 2019 stetig und machten damit Einsparungen in anderen Sektoren wieder zunichte. Wegen der Pandemie gab es einen Knick, seit 2021 sinken die Verkehrs-Emissionen sogar leicht, aber nicht schnell genug. Gleichzeitig hat laut ÖROK fast ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung keine adäquate Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Der Mobilitätsmasterplan 2030 des Klimaschutzministeriums bezeichnet das Erreichen der Klimaneutralität in diesem Sektor nicht umsonst als ›Jahrhundertprojekt‹.
Aber einfach alle Verkehrsmittel mit erneuerbaren Energien zu betreiben, reicht nicht für die Mobilitätswende. Es muss nicht nur emissionsfrei gefahren werden, sondern auch insgesamt weniger. Dafür müssen die Österreicherinnen und Österreicher umsteigen: Von allein zu gemeinsam, vom motorisierten Individualverkehr (MIV) zu den Öffis, vom Auto zur Bahn.
›Eine Information zu Railjet 860 nach Stuttgart Hauptbahnhof. Abfahrtszeit 10:08 Uhr. Dieser Zug fährt voraussichtlich zehn bis 15 Minuten später ab.‹ Am Bahnsteig fünf in Meidling werden genervte Blicke getauscht. Chris Lohners Automatenstimme verdeutlicht, dass selbst in Wien, dem Startpunkt meiner Öffi-Odyssee, nicht alles auf Schiene ist. Aktuell sorgen die S-Bahn nach Floridsdorf, die U4 zum Schwedenplatz oder die 43er-Bim zum Schottentor für Unmut. Allesamt wichtige Linien, allesamt gesperrt. Und das bei zwei Millionen täglichen Fahrgästen. Auch am Bahnhof Meidling wird umgebaut, glücklicherweise nur im Inneren. Mit einem sanften Ruck beginnt die Reise dann, eine Station lang stehe ich noch – auch dieser Zug ist voll. Die ÖBB hat 2023 einen neuen Fahrgastrekord aufgestellt, sieben Prozent mehr als 2019.
Doch bevor ich zum Sitzen und der Zug zum Stehen kommt, passieren wir schon Bürg-Vöstenhof. Vom Zug aus ist die 160-Einwohnergemeinde im südlichsten Niederösterreich nicht zu sehen, auch von oben wäre sie schwerlich als solche erkennbar. Wie Perlen fädeln sich einzelne Häuser an einer Straßenkette über ein paar Hügel, dazwischen nur Wald und Felder.
›Die verfehlte Raumordnung der letzten 20 Jahre zieht einen ganzen Rattenschwanz an Folgeproblemen hinter sich her‹, sagt mir Ulrich Leth, Forscher und Lehrender am Institut für Verkehrswissenschaften der TU Wien im Interview, das ich als Reisevorbereitung mit ihm geführt habe. Wo die Menschen wohnen, bestimmt, wie ihre Wege aussehen und meistens auch, wie sie diese zurücklegen. Raumordnungspolitik ist also auch Verkehrspolitik. Stark zersiedelte Gebiete wie das nördliche Waldviertel und das südliche Burgenland sind bekannte Negativbeispiele. ›Es bräuchte viel mehr Anreize und striktere rechtliche Rahmenbedingungen‹, sagt Leth, ›aktuell wird es nicht besser, weil noch immer Einfamilienhäuser auf der grünen Wiese gebaut werden.‹
Wo es unwirtschaftlich ist, eine eigene Bus- oder Bahnlinie hinzulegen, versucht man, diese Einfamilienhäuser über sogenannten Mikro-ÖV, also bedarfsorientierte Sammeltaxis oder Kleinbusse, mit den Hauptachsen zu verbinden. Im niederösterreichischen Schwarzenbach an der Pielach stünden sogar E-Tankstellen dafür bereit, allein der elektrische Siebensitzer fehlt. Die kleine Gemeinde ›kann und will‹ sich die 30.000 Euro dafür nicht leisten. Förderungen vom Land gebe es keine. ›Wir werden im Regen stehen gelassen‹, moniert Bürgermeister Andreas Ganaus übers Telefon. Am Wochenende fahren Gemeindemitarbeiter mit ihren Privatwagen Touristen und Einheimische vom Bahnhof in den Ort. Wenn eine Gruppe zu groß ist, wird das Feuerwehrauto bemüht. Eine langfristige Lösung ist das nicht.
Es würde weitere 20 Jahre dauern, bis Maßnahmen in der Raumordnung bei der Anbindung Abhilfe schaffen. ›Mit dem Öffi-Angebot kann man jetzt auch nur an den Symptomen ein bisschen herumdoktern‹, sagt Verkehrsforscher Leth. Doch auch mit dem Angebot am Land sieht es nicht rosig aus. Laut Greenpeace ist Österreichs Schienennetz seit 1955 um 655 Kilometer – hauptsächlich Nebenbahnen – geschrumpft. Viel wurde mit flexibleren, aber weniger attraktiven Bussen ersetzt, die viele Nachteile des MIV mit sich bringen (etwa die Abhängigkeit von der Verkehrslage), dabei aber nicht den Komfort des Privat-PKW bieten. Von allen stillgelegten Bahnstrecken befand sich jede zweite in Niederösterreich.
Jede zweite der acht österreichischen Gemeinden ohne Haltestelle wiederum befindet sich in Oberösterreich. Und mittlerweile auch mein Zug, der gerade durch den Bahnhof Marchtrenk rauscht. Wenn auch für mich kein Stopp, ist diese Station doch für die Gemeinde Holzhausen der nächste große Verkehrsknotenpunkt. Für eine sichere Verbindung versucht die Gemeinde seit Jahren einen Radweg dorthin zu bauen. Ein Mikro-ÖV-Angebot hatten die Holzhausner zuvor abgelehnt. ›Bis jetzt hat gar nichts funktioniert, aber der Radweg würde funktionieren, da bin ich überzeugt. Nur haben wir den rechtlich noch nicht durchgebracht‹, sagt Ersatz-Gemeinderat Thomas Roitmeier. Die Grundstückseigentümer entlang der ebenen Straße, laut Roitmeier alteingesessene Bauern, weigern sich, einen Teil ihres Landes für die sichere Radverbindung zum Bahnhof zu verkaufen. Der Konflikt beschäftigte sogar schon das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich.
Die Zubringermobilität – das Radfahren und Zu-Fuß-Gehen – ist besonders wichtig für die Verlagerung von Personen auf nachhaltige Verkehrsmittel. Denn wenn die Menschen schon einmal im Auto zum Bahnhof müssen, stellt sich für viele die Frage: Warum nicht gleich bis zum Ziel durchfahren? ›Deshalb sollte das eigentliche Ziel sein, die Menschen möglichst nicht ins Auto, sondern am kürzesten Weg zur nächsten Haltestelle zu bringen‹, sagt Ulrich Leth. Auch das E-Bike eröffne hier neue Möglichkeiten.
Vor dem Halt in Salzburg passiert mein Zug noch drei Orte. Einer davon ist St. Veit im Innkreis. Dort wurde vor Langem die einzige lokale Buslinie eingestellt. Aber dass die Gemeinde mit Mikro-ÖV den Bus ausgleichen könnte, sei weder finanzierbar noch je im Gespräch gewesen, meint der Bürgermeister. ›In meinen zehn Jahren im Amt hat mich nie jemand darauf angesprochen‹, sagt Manfred Feichtinger, der auch der örtliche Nah-und-Frisch-Gebietsleiter ist.
Kein Wunder, dass es in Pfaffing und Fornach nicht anders klingt. Die zwei Nachbargemeinden sind mit insgesamt knapp 2.500 Einwohnern das größte nicht erschlossene Gebiet, und wären da nicht überall Bäume an den Schienen gepflanzt, ich könnte sie vom Zugfenster aus sehen. Ich erreiche den Fornacher Bürgermeister Hubert Neuwirth beim Holzarbeiten im Wald. ›Wenn wir das Geld für einen Kleinbus hätten und in die Hand nehmen würden, dann würde das auch funktionieren‹, sagt der hauptberufliche Landwirt, ›aber das haben wir nicht. Wir haben gelernt, dass wir hier ein Auto brauchen.‹
›Es ist extrem schwer, mit Mikro-ÖV wirklich konkurrenzfähig zum Auto zu sein, von dem jeder und jede oft mehrere direkt vor der Haustür stehen hat‹, sagt Verkehrsforscher Leth. Am Land gibt es keine Einschränkungen, die den Autoverkehr unattraktiver machen. Keinen Parksheriff mit Strafzettel im Anschlag, keine Citymaut, keinen Stau.
Mittlerweile ist der Railjet Richtung Stuttgart Hauptbahnhof nur mehr fünf Minuten verspätet, mein Handynetzbetreiber begrüßt mich kurz in Deutschland, und leise hallen die Geräusche eines Mario-Kart-Rennens durch die Sitzreihen. Draußen ist die flache Hügellandschaft steilen Berghängen und der Sonnenschein einem Regenschauer gewichen. Nach Innsbruck wechselt auch der Schaffner zum dritten Mal.
Dass ein paar Menschen wegen der Siedlungsstrukturen immer aufs Auto angewiesen sein werden, lässt sich wohl nie ganz vermeiden. Ein Blick auf die Tiroler Gemeinde Namlos, gegenüber vom Arschberg (sic), macht das umso klarer. Das 58-Seelen-Dorf schrumpft seit Jahren und liegt direkt an einer Durchzugsstraße. Bürgermeister Walter Zobl bemüht sich um eine Buslinie oder Ähnliches, aber eigentlich nur wegen des Tourismus. Einen Termin beim Landeshauptmann habe er, nur noch kein Datum dafür.
So hart es klingt: Muss man bei Gemeinden wie Namlos darauf warten, dass die Landflucht ihnen den Rest gibt? ›Klar wäre es sinnvoller, wenn die Menschen in abgegrenzten, dichter bebauten Gebieten wohnen würden‹, sagt Leth vorsichtig. ›Mit denselben Investitionen erreicht man in der Stadt eben mehr Menschen.‹
Südlich von Namlos, am Bahnhof in Landeck, warte ich eine halbe Stunde auf den Bus 210, der mich direkt zur Talstation bringt. Fendels hat ähnliche Probleme wie die anderen Gemeinden und ist doch anders. Eine Gondelbahn führt direkt an das Örtchen. Hier in den Tiroler Bergen haben 281 Fendlerinnen und Fendler letztes Jahr kurz ein Fenster in eine alternative, nachhaltigere Realität geöffnet.
Fendels hat den typischen Bergdorf-Charme. Holzdächer, blumenbefüllte Balkone, weiße Häuser und so wenige davon, dass es keine Straßennamen gibt, nur Nummern. Auch gibt es keinen Supermarkt, keinen Bankomaten. Trotzdem wächst das Dorf, am linken äußeren Hang wird gerade wieder ein neues Haus errichtet. Der große Parkplatz vor dem Vier-Sterne-Hotel ist voll, auch mit niederländischen Familienautos. So voll, dass das Hotel einen Hang weiter unten gerade eine Tiefgarage neu dazubaut.
Im Sommer 2023 mussten die zwei Natursteintunnel, durch die die Gemeinde mit der Außenwelt verbunden ist, renoviert und dafür gesperrt werden. Als Ausweichroute war eine staubige, steile Schotterpiste die einzige Option. Die Urlauber waren genervt, die Fendler wichen aus. Für diese paar Monate lief die Gondelbahn nämlich auf Hochtouren und brachte Pendler vom Berg ins Tal, die Betriebszeiten wurden um zwei Stunden in der Früh und um eine Stunde am Abend erweitert. ›Es sagen mir heute noch Einheimische: »Ma, desch wor scho fein«‹, sagt der Betriebsleiter der Seilbahn, Christian Strobl. In der Gondel ist das Hinauffahren sogar ein paar Minuten schneller als im Auto.
Es war nicht der erste Anlauf, die Seilbahn als öffentliches Verkehrsmittel für Fendels zu etablieren. Vor Corona wollten das Land und der Verkehrsverbund Tirol die Seitentäler des Inntals – und damit auch Fendels – ordentlich anbinden. Damals war der Wunsch der Einheimischen, von sechs in der Früh bis acht am Abend mit der Gondel fahren zu können. Momentan startet die letzte Tal- und Bergfahrt um 16:45. ›Es wäre eine elegante Lösung gewesen, auch umwelttechnisch‹, sagt die Geschäftsführerin des Seilbahnbetriebs. Aber nach mehreren konkreten Gesprächen sei das Vorhaben beim Land Tirol ›hängen geblieben‹. Erst in der Notlage ohne funktionierende Autoverbindung hatte man sich auf die Seilbahn besonnen.
In Wien, Graz und Salzburg war sie schon im Gespräch, realisiert wurde nie eine. In mehreren Millionenstädten Lateinamerikas ist die Seilbahn aber sehr wohl als öffentliches Verkehrsmittel im Einsatz. Sinnvoll ist das vor allem, wenn große Höhenunterschiede oder Flüsse zu überwinden sind. ›Seilbahnen haben begrenzte Einsatzbereiche, weil sie nicht so leistungsfähig sind. Aber gerade dort, wo es wirklich keine Alternative gibt, macht es Sinn‹, sagt Verkehrsforscher Leth. Also in Fendels doch eine Option für die Zukunft?
›Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Aber das wäre finanziell … also das ist unbezahlbar‹, sagt Bürgermeister Stefan Köhle. Allein für die Zeit der Tunnelsperre hat die kleine Gemeinde 100.000 Euro in die Hand nehmen müssen, und das Land hat ebenfalls Geld zugeschossen. ›Die Seilbahn ist eben eine beinharte Rechnerin. Aber das kann ich verstehen, die müssen ja schließlich auch von etwas leben‹, sagt Köhle.
Auch der Besitzer meiner Unterkunft, des Hotels Alpenrose, fand die Zeit, als die Gondelbahn länger fuhr, ›lässig‹. Nur war für ihn klar: Das ist nicht für immer. ›Solange wir nicht umdenken und weniger bequem werden, ändert sich da nix!‹, sagt der Hotelier. Er selbst ist während der Tunnelsperre nicht mit der Gondel, sondern mit seinem Quad über den Schotter gefahren. Als ich Anfang August auf dem Fendler Plateau ankomme, ist alles wieder beim Alten. Im Zehn-Minuten-Takt schlängeln sich Autos die Bergstraße hinunter.
Österreich ist immer noch ein ›PKW-Regime‹, wie Leths Kollegin Barbara Laa in einem Forschungspapier 2021 feststellt. Infrastruktur für Autos begünstige nur mehr Autos, die wiederum mehr Straßen benötigen. Das ist auch der Grund dafür, dass mehr Straßen nicht weniger Stau bedeuten. Es brauche deshalb eine ›Mobilitätswende in den Köpfen‹. ›Das Wissen um Systemwirkungen fehlt in der Diskussion‹, sagt Verkehrsforscher Leth. ›Ich stehe im Stau, mit einer Spur mehr stehe ich nicht im Stau. Dass ich drei bis fünf Jahre später wieder im Stau stehe, weil noch mehr Leute mit dem Auto fahren, dieser Zusammenhang ist viel zu weit weg für die Menschen.‹ Ein wohlbekanntes Problem in vielen Dimensionen der Klimakrise.
Obwohl meine Reise kein allzu gutes Bild vom Fortschritt der Mobilitätswende im ländlichen Raum zeichnet, ist bei Weitem nicht alles schlecht. In fast allen acht kleinen Gemeinden ist zumindest die Energiewende angekommen, sie haben E-Ladeinfrastruktur und Photovoltaik ausgebaut, im südlichen Burgenland wurde gerade ein umfassendes Mikro-ÖV-System ausgerollt, und auch die Urlaubsreisen mit der Bahn haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Aber Tempo 100 auf der Autobahn und ähnliche niederschwellige, aber polarisierende Maßnahmen bleiben ›Transport-Tabus‹, wie Laa schreibt. Dabei wären genau diese Tabus unter den wirksamsten Maßnahmen, wie das Umweltbundesamt bereits 2018 im Sachstandsbericht Mobilität festgestellt hat. Bis zur Erreichung unserer Klimaziele ist der Weg also noch weit. Ähnlich weit wie von Wien nach Fendels. •